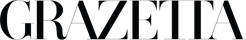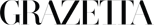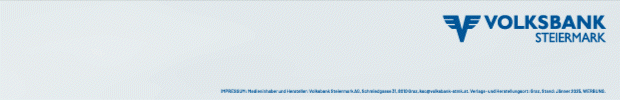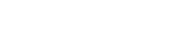Allergien sind die Epidemie des 21. Jahrhundert, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Wie man Allergien bei Kindern erkennen kann und welche Forschungsansätze für Diagnose und Behandlung vielversprechend sind, erklären Grazer Allergologen.
Dass Allergien zunehmen, bestätigt auch der Allergologe Birger Kränke von der MedUni Graz: „Verschiedene Allergieerkrankungen nehmen weltweit zu, davon kann man ausgehen.“ Dass Allergien auf dem Vormarsch sind, ist also unbestritten. Ebenso klar ist die medizinische Erklärung für diese Erkrankung: „Eine Allergie ist eine Fehlleistung des Immunsystems“, erklärt Kränke. „Es erkennt Stoffe als gefährlich, die das eigentlich nicht sind.“ Was das Immunsystem dazu bringt, auf harmlose Substanzen mit Abwehrmaßnahmen zu reagieren, da gehen die Meinungen auseinander. Adrienn Weingärtner, Fachärztin für Pulmonologie und Allergologie an der Kinderklinik Graz, spricht von multifaktoriellen Ursachen: „Es gibt verschiedene Risikofaktoren und Prädispositionen.“ Erbliche Belastung sei ein wichtiger Risikofaktor: „Kinder, deren Eltern beide Allergiker sind, haben eine 50- bis 60-prozentige Chance, selbst Allergien zu entwickeln“, betont Weingärtner. „Ist nur die Mutter oder der Vater Allergiker, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 30 Prozent.“ Zum Vergleich: Gibt es keine erbliche Vorbelastung liegt der Anteil der Allergiker an der Gesamtbevölkerung zwischen zehn und 15 Prozent.
Birger Kränke, Leiter der Allergieambulanz am Universitätsklinikum Graz, betont, dass die konkreten Sensibilisierungen und Allergien immer erworben sind: „Das Immunsystem muss sich jeden Tag mit der Umwelt auseinandersetzten“, argumentiert er. „Je mehr beziehungsweise öfter Fremdstoffe mit dem Immunsystem Kontakt haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass das Immunsystem eine Fehlleistung erbringt.“
Was auch damit zu tun hat, dass Menschen in der industrialisierten westlichen Welt regelmäßig mit 50.000 Chemikalien zu tun haben. Haut und Schleimhäuten können darauf reagieren. „Von diesen 50.000 Chemikalien wissen wir, dass 4.000 davon Kontaktallergene sind, die zum Beispiel zu Ekzemen führen können.“ Die Chemikalien sind in unserer Kleidung, in der Kosmetik aber auch in Materialien enthalten, mit denen wir es in der Arbeit zu tun bekommen. Dass das Immunsystem da einmal den Kopf verliert, ist also alles andere als ein Wunder. „Je häufiger der Kontakt stattfindet, desto eher besteht die Chance auf eine Fehlreaktion des Immunsystems“, erklärt Kränke und liefert dafür einen recht eingängigen Vergleich: „Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Zeitung Buchstabe für Buchstabe lesen. Bei den ersten Wörtern wird Ihnen wohl kaum ein Fehler unterlaufen. Aber nach ein paar hundert Wörtern wird man ziemlich sicher einen Fehler machen.“ Eine Rolle dürften auch Umweltfaktoren spielen: Diesel- und Ozonpartikel, Tabakrauch-Exposition und Schimmelbelastung in Wohnräumen zum Beispiel.

„Erbliche Belastung als Risikofaktor für Kinder.“
ADRIENN WEINGÄRNTER
Allergologin an der Kinderklinik Graz
Und wie steht es mit der Hypothese, dass übertriebene Hygiene der Grund sein könnte, dass sich ein unterfordertes Immunsystem an sich harmlose Stoffe sucht, die es
als gefährlich einstuft? Dass also Kinder Schmutz brauchen? Adrienn Weingärntner ist skeptisch, denn zu ihr kommen auch Bauernhofkinder mit Allergien. Dem entgegen steht allerdings eine Untersuchung in Deutschland nach dem Fall der Berliner Mauer zur sogenannten Hygiene-Hypothese. „Man hatte die Möglichkeit zwei genetisch sehr ähnliche Bevölkerungsgruppen zu untersuchen, um herauszufinden, ob in einer mehr Allergiker vorkamen als in der anderen“, berichtet Kränke. „Das Ergebnis war, dass im Osten die Häufigkeit geringer war. Weil es in der ehemaligen DDR große landwirtschaftliche Betriebe gab und die Umwelt aufgrund der vielen Kohlekraftwerke auch stärker verschmutzt war. Die Hygiene-These ist meiner Meinung nach weiterhin zu beachten.“ Auch wenn in puncto Hygiene die Meinungen auseinander gehen, als Auslöser unumstritten sind vor allem bei Kindern Faktoren wie verrauchte Innenräume und Schimmelbefall in der Wohnung. „Das ist ein großer Risikofaktor für Allergien im Bereich der Atemwege bei Kindern“, betont Weingärtner.
Allergien treten bei Kindern allerdings in unterschiedlichen Lebensphasen auf, ganz einfach deshalb, weil es eine gewisse Zeit der Exposition braucht, bis sich eine Allergie entwickelt: „Säuglinge haben deshalb keine Pollenallergie“, sagt Weingärtner. „Für Säuglinge typisch sind Neurodermitis und Nahrungsmittelallergien.“ Kuhmilch, Eiklar und Weizen sind die häufigsten Bösewichte. Tierhaarallergien oder Hausstaubmilbenallergien treten vermehrt im Kleinkindalter auf, Pollenallergien meist ab dem Vorschulalter. „Ein Großteil der Lebensmittelallergien verschwindet mit zunehmendem Alter. Es kommt meistens zu einer natürlichen Toleranzentwicklung.“
Womit Weingärtner aber nicht sagen will, dass Eltern einfach abwarten sollten. Denn Lebensmittelallergien machen das Leben ziemlich kompliziert, wenn es um die Ernährung geht. Weingärtner rät Eltern daher ihr Kind in ein Fachzentrum zu bringen. Hier kann geklärt werden, ob eine kontrollierte Gabe der Nahrungsmittel die Toleranzentwicklung beschleunigen kann, oder ob eine orale Immuntherapie (OIT) zielführender ist. „In ersterem Fall wird in Zusammenarbeit mit einer Diätologin ein Ernährungsplan entwickelt, der dafür sorgt, dass das Kind in ganz kleinen Mengen regelmäßig mit dem Allergen konfrontiert wird. Im Laufe der Behandlung wird die Dosis Schritt für Schritt erhöht.“ Wichtig sei es aber, zu überprüfen, ob und wann die allergische Reaktion abgeklungen ist. Viele Kinder, bei denen eine bestimmte Lebensmittelallergie diagnostiziert wurde, würden oft viele Jahre später diese Lebensmittel immer noch vermeiden, obwohl das schon längst nicht mehr notwendig ist. „Wir wissen heute, dass das zu Verhaltensauffälligkeiten bei den Essgewohnheiten führen kann“, erklärt Weingärtner.
„Die Forschung sucht nach konkreten Eiweißstrukturen, auf die das Immunsystem reagiert.“
BIRGER KRÄNKE
Leiter der Allergie-Ambulanz
am Universitätsklinikum Graz

Hat das Kind zum Beispiel eine allergische Reaktion auf Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare entwickelt, rät Weingärtner dazu, rechtzeitig therapeutische Maßnahmen einzuleiten: „Die Gefahr ist, dass es zu einem sogenannten Etagenwechsel kommt, dass aus einer Allergie ein allergisches Asthma wird. Generell gilt, je jünger das Kind ist, umso besser.“ Ein allergisches Asthma sei nämlich nicht heilbar. Eine weitere therapeutische Möglichkeit ist die sogenannte Systemischen Immuntherapie (SIT), bei der das Allergen in geringen Dosen wie bei einer Impfung gespritzt wird. Für kleine Kinder ist das kein Honigschlecken. Subkutane Th erapien sind ab dem 5. Lebensjahr zugelassen, in den ersten 12 Wochen bedeutet das eine Spritze pro Woche, im zweiten Th erapiejahr alle sechs Wochen. „Dazu muss man ein Kind erst einmal kriegen“, gibt Weingärtner zu. Bei der Systemischen Immuntherapie können die Allergene aber auch oral, in der Form von Tabletten oder Tropfen verabreicht werden.
Allergologe Birger Kränke sagt, dass die Forschung in Bezug auf die Behandlung von Allergien große Fortschritte macht. „In der Forschung geht es darum, immer präziser herauszufinden, worauf das Immunsystem reagiert“, erklärt Kränke. „Zum Beispiel bei der Birkenpollen-Allergie: Früher hat man gegen Birkenpollen geimpft . Heute weiß man, dass Birkenpollen mindestens acht bekannte Unter-Antigene haben, also Eiweißstrukturen, auf die das Immunsystem reagiert.“ Es geht also darum, genau jenes Eiweiß zu identifizieren, das die Allergie auslöst. Wichtig sei dieser Ansatz auch deshalb, weil man damit auch erklären kann, warum es zu sogenannten Kreuzreaktionen kommt. Dass man als Birkenallergiker auch auf Soja reagiert. „Bestimmte Strukturen der Birkenpollen kommen auch in der Sojabohne vor. Die meisten Nahrungsmittelallergien werden also über Pollen erworben.“
In der Diagnose sei es möglich, diese Eiweißstrukturen zu erheben. „Die entsprechenden Impfstoffe zu entwickeln, dafür braucht es noch Zeit. Aber in diese Richtung geht in der Medizin die Reise hin.“
Fotos: Benjamin Gasser, Med Uni Graz, iStock