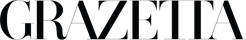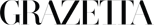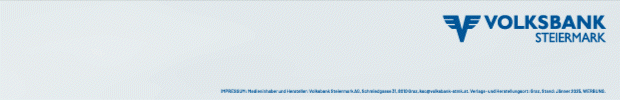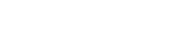Die Grazerin Stefanie Hadolt akquiriert in New York Kapital für große Infrastrukturprojekte in Nord- und Lateinamerika. Im GRAZETTA Interview spricht sie über das Arbeiten in einem multikulturellen Umfeld und erklärt, warum sie sich im Big Apple so wohl fühlt.
GRAZETTA • Seit Dezember letzten Jahres arbeiten Sie in New York für das Private Equity Unternehmen Antin, ein Unternehmen, das Infrastruktur-Unternehmen kauft und ausbaut. Welche Aufgaben haben Sie bei Antin?
STEFANIE HADOLT • Wir akquirieren Firmen, die sich mit gesellschaftlich essentieller Infrastruktur beschäftigen. Es handelt sich um Unternehmen meist in Privatbesitz, die in Europa und in Nordamerika aktiv sind. In unserem Portfolio haben wir zum Beispiel eine Solarfirma, ein Glasfaser-Unternehmen und ein Eisenbahnunternehmen. Meine Aufgabe ist es, Fremdkapital zu akquirieren. Wenn Antin ein Unternehmen übernimmt, braucht es dafür meist auch Fremdkapital. Ich sorge dafür, dass wir das nötige Fremdkapital haben. Die Firmen bleiben dann meistens in einem Zeitraum von zwischen fünf und acht Jahren in unserem Besitz. Bei Antin hat jede Firma ein eigenes Management, das dafür verantwortlich ist, dass das Unternehmen wachsen kann. Unser Schwerpunkt liegt dabei bei der Wertschöpfung.
Was macht die Faszination Ihres Jobs aus?
SH • Ich habe immer an großen Infrastrukturprojekten gearbeitet. Wenn es um Straßen, um Hafenanlagen und Solaranlagen geht, kann man sehen, wofür man arbeitet. Mir ist es wichtig, an Infrastrukturprojekten zu arbeiten, die der lokalen Bevölkerung zugutekommen und die gesellschaftlich wichtig sind. Ein Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang immer gerne nenne, war ein Projekt in Lateinamerika, in dem es um die Finanzierung der Elektrobusse ging, mit denen der Ausstoß von Treibhausgasen in der Region deutlich reduziert werden konnte. Es geht also um sehr konkrete, aber auch um sehr komplexe Projekte.
An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
SH • Mein Schwerpunkt ist die Finanzierung für sogenannte essentielle Infrastruktur-Investments, das ist ein weites Betätigungsfeld, da geht es um erneuerbare Energien, Digitalisierung, um Elektromobilität, aber auch Projekte im Gesundheitswesen zählen in unserem Unternehmen zur essentiellen Infrastruktur.

„Die Bereiche Banken und Infrastruktur Investments sind immer noch eine Männerdomäne, auch wenn sich das langsam ändert.“
Sie haben an der London School of Economics und an der Universität Peking studiert. Ihre ersten Jobs hatten Sie in London und Tokio. Was unterscheidet eine Karriere im internationalen Umfeld von einer in Österreich?
SH • Stimmt, in Österreich habe ich noch nie gearbeitet. Eines ist für mich klar: Egal, wo man arbeitet, es gibt immer eine lokale Mentalität. Was aber nicht bedeutet, dass es zwischen Jobs in Japan oder in New York nicht auch viele Übereinstimmungen gibt.
Bei Ihrem derzeitigen Arbeitgeber arbeiten rund 40 verschiedene Nationalitäten. Was bedeutet es, in einem multikulturellen Umfeld zu arbeiten?
SH • Wie es ist, in einem kulturell homogenen Umfeld zu arbeiten, weiß ich eigentlich nicht. Das hat auch etwas mit meinem persönlichen Hintergrund zu tun. Mein Vater ist Österreicher, meine Mutter Japanerin. Ich bin also multikulturell aufgewachsen, zuhause wurden verschiedene Sprachen, gesprochen und japanisch und steirisch gekocht. Die Welt außerhalb der Familie war in meiner Kindheit und Jugend schon noch sehr homogen und wenn man, wie ich, ein wenig anders aussieht, galt man schon noch als Exot.
Warum ist es für ein Unternehmen wie Antin wichtig, mulikulturelle Teams an Bord zu haben?
SH • Multikulturelle Teams sind Teil der DNA meines Unternehmens, den Gründern von Antin ist eine internationale Belegschaft sehr wichtig und daran wird auch festgehalten.
Was ist der Mehrwert dieser Diversität für das Unternehmen?
SH • Der Mehrwert ist die Vielfalt. Ich gebe ein Beispiel: in diesem Job wird man andauernd um seine Meinung gefragt, die Antworten spielen eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess. Wenn man in einem Unternehmen 50 weiße Amerikaner im Alter von 50 Jahren hat, dann bekommt man wahrscheinlich recht einheitliche Antworten. Hat man ein Team, in dem es viele Frauen gibt und Mitarbeiter aus verschiedenen Herkunftsländern, aus verschiedenen Altersgruppen, gibt es eine größere Vielfalt bei der Sicht der Dinge, die den internen Austausch spannend und produktiv macht. Dieser Austausch ist auch für mich sehr bereichernd, nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Apropos Männer jenseits der 50. Wie steht es mit der Position von Frauen in Ihrer Branche?
SH • Die Bereiche Banken und Infrastruktur Investments sind immer noch eine Männerdomäne, auch wenn sich das langsam ändert. In meinem Unternehmen gibt es für mich viele Möglichkeiten, mich mit Frauen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir gehen gerne gemeinsam aus. Wir sprechen natürlich auch über das Business, aber wir sprechen auch über private Dinge. Trotzdem muss ich sagen, dass es für mich am Anfang meiner Karriere in dieser Männerwelt nicht einfach war. Meine Mentoren waren zwar meist Männer, sie haben mich auch immer unterstützt. Meine Karrieresprünge habe ich auch ihnen zu verdanken, aber dennoch schätze ich es von talentierten und intelligenten Frauen umgeben zu sein.
„New York gibt einem das Gefühl, dass man anders sein kann und trotzdem Teil der Gesellschaft ist.“

Wie würden Sie das Arbeiten mit Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund beschreiben?
SH • Mein letztes Team bestand aus acht Kollegen aus sechs Nationen. Die Arbeitssprache ist Englisch, aber jeder hat seine eigene Art sich auszudrücken. Alle Team-Mitglieder beherrschen zwar das Vokabular des Business-English, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man sich immer versteht. Und das kann schon einmal eine Herausforderung sein.
Könnten Sie dafür ein Beispiel geben?
SH • In Japan wird auf Vorschläge sehr oft mit Zustimmung reagiert. Ganz einfach deshalb, weil das als höflich gilt. Was aber nicht bedeutet, dass der Vorschlag wirklich angenommen wird. Die Absage kommt dann per E-Mail. Man findet es nicht angebracht, einen Vorschlag direkt abzulehnen.
Sind diese kulturellen Unterschiede nicht manchmal auch eine Belastung?
SH • Natürlich, weil man sich manchmal wünschen würde, etwas in der eigenen Muttersprache sagen zu können. Aber man entwickelt im Laufe der Jahre auch ein Gespür dafür, wie man sich einem bestimmten Kunden gegenüber oder in einer bestimmten Situation verhalten muss. Das ist oft eine sehr intensive Erfahrung, die nicht nur angenehm, sondern auch sehr effizient sein kann.
Verändert einen die Arbeit in multikulturellen Teams auch selbst?
SH • Ich glaube schon. Wenn man zehn Stunden pro Tag in einem multikulturellen Umfeld arbeitet, Freunde verschiedener Herkunft hat, wird einem fast langweilig, wenn man das nicht hat.
Wie gehen Sie in Ihrer Familie damit um?
SH • Mein Mann ist in den USA aufgewachsen, er hat deutsche Eltern. Meine zwei Kinder gehen in einen deutschsprachigen Kindergarten in New York. Dort sind nicht nur Kinder mit einem deutschen, österreichischen oder schweizerischen Hintergrund. Die meisten Kinder haben irgendeinen Bezug zur deutschen Sprache, in Wirklichkeit sind in diesem Kindergarten aber die Vereinten Nationen vertreten.
Man entwickelt ein Gespür dafür, wie man sich einem bestimmten Kunden gegenüber oder in einer bestimmten Situation verhalten muss.
Werden Ihre Kinder mehrsprachig erzogen?
SH • Das geht eigentlich ganz von selbst. Mein Sohn ist zwei Jahre alt, meine Tochter noch nicht einmal ein Jahr. Mein Sohn spricht ja noch nicht fließend, aber er kennt deutsche, japanische, englische und spanische Wörter. Spanisch deshalb, weil wir einmal eine spanischsprachige Nanny hatten. Für ihn ist das Teil seines Alltags und die verschiedenen Sprachen sind für ihn ganz normal, weil er es auch nicht anders kennt.
Was schätzen Sie an New York?
SH • Was diese Stadt auszeichnet, ist, dass jeder akzeptiert wird und man nicht gefragt wird, woher man kommt. Das war in meiner Jugend in Österreich anders. Da wurde ich immer gefragt, woher ich komme. Und wenn ich dann geantwortet habe, aus Graz, wurde weitergefragt: ‚Woher kommst du eigentlich?‘. Das hat mich schon geprägt. Vielleicht hat sich das ja inzwischen ein wenig geändert, aber ich habe das damals als schrecklich und als nervig empfunden. In New York passiert einem das nicht. Ich kann beruhigt sagen, ich bin aus New York, ohne schräg angeschaut zu werden. Das liegt auch daran, dass ja niemand ursprünglich aus Amerika ist. New York gibt einem das Gefühl, dass man anders sein kann und trotzdem Teil der Gesellschaft ist. Man wird nicht als Außenseiter gesehen. Davon könnten sich viele andere Länder und Kulturen etwas abschneiden.
Was vermissen Sie in den USA?
SH • Das fragen mich auch meine österreichischen Freunde oft. Ich habe das auch mit meinem Mann besprochen und wir sind uns einig: Wir vermissen die historischen Stadtzentren mit den kleinen Gassen, den alten Häusern und den traditionellen Cafés. Die gibt es in New York nicht. Man kann auf den New Yorker Avenues nicht wie in kleinen Gassen flanieren. Man kann auch nicht einfach stehenbleiben, weil man dann von den anderen Fußgängern weitergeschoben wird. Wenn wir nach Österreich fliegen, dann immer mit leeren Koffern, damit wir viel auf der Heimreise mitnehmen können: Steirischen Wein, Schwarzbrot, Manner Schnitten und Elmex-Zahnpasta. Es gibt eben gewisse Dinge, die man gewohnt ist und ohne die man nicht auskommen möchte. Aber diese Dinge sind für mich kein Grund, zurück nach Österreich zu ziehen. Womit ich aber nicht sage, dass eine Rückkehr nach Österreich für meine Familie und mich für immer ausgeschlossen ist. In meine jetzige Lebensphase passt eine Rückkehr nach Österreich nicht. Und vielleicht ist ja der erste Schritt eine Rückkehr nach Europa.
Fotos: Michaela Pfleger