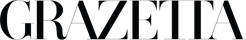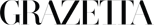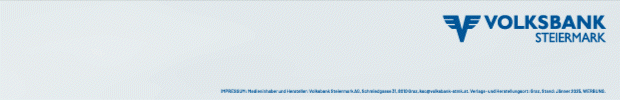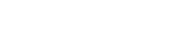Wieviel Zusammenhalt braucht eine Gesellschaft? Und wo sind die Grenzen unserer Freiheit?
Dieser Frage hat die Pandemie neues Gewicht verliehen.
Größer könnte der Gegensatz wohl nicht sein: Vor eineinhalb Jahren spielten Musiker vor Altersheimen, um den Bewohnern im Lockdown eine Freude zu machen. Ärzten und Pflegern wurde applaudiert. Heute ist das Bild ein anderes. Wütende Menschen demonstrieren vor den Spitälern. Radikale Impfgegner bedrohen Ärzte, Bürgermeister und Journalisten.
Wie ist es möglich, dass sich die Stimmung in kurzer Zeit so grundlegend geändert hat? Die Frage beschäftigt Psychologen, Soziologen und Politologen. Zu eindeutigen Antworten finden sie nicht. Einen Ansatz liefert die deutsche Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff: „Je größer die Verunsicherung ist, umso eher rücken die Menschen zusammen“, sagt sie. „Aber je länger eine Krise andauert, desto mehr lässt der Zusammenhalt nach.“
Man gewöhne sich an den Ausnahmezustand und damit bekommen egoistische Motive
mehr Gewicht. Umso mehr, als ein Ende der Gesundheitskrise nicht absehbar sei. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft wird schwächer, die Bereitschaft, staatliche Vorgaben
einzuhalten, nehme ab. Dass Deitelhoff damit recht haben dürfte, zeigen die wöchentlichen
Demonstrationen, bei denen Zehntausende ihren Unmut äußern. Man demonstriert
im Namen von Grund- und Freiheitsrechten und sieht in der von Experten und Regierung verordneten Impfpflicht einen Angriff auf die Grundfesten der Demokratie. Der Philosoph Richard David Precht bestätigt dies in seinem Buch „Von der Pflicht“: „Während der weitaus größte Teil der Menschen Empathie mit den Schwachen und besonders gefährdeten Menschen zeigt, entpflichtet sich eine Minderheit und rebelliert.“
17 Prozent der Befragten sagen, dass sie keinen Einfluss mehr darauf hätten, was mit ihnen geschieht.
Ifes-Studie
Was verrät dies nun über den Zustand unserer Gesellschaft? Precht spricht von einem Spannungsfeld zwischen Recht und Pflicht, also zwischen dem Recht auf Autonomie und der Pflicht, das Allgemeininteresse der Gemeinschaft im Auge zu behalten. Precht erklärt die Corona-Proteste der letzten Wochen mit einer historischen Entwicklung. Seit der Mitte der 1980er Jahre habe sich mit dem Siegeszug des Neoliberalismus die Gewichtung verschoben.
Der Staat wurde zum Inbegriff allen Übels, das Private in Wirtschaft und Gesellschaft zum überlegenen Problemlöser. 1960 hatte US-Präsident John F. Kennedy bei seiner Antrittsrede noch gefragt: „Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt.“ Heute hat es den Anschein, als wäre uns mit den Privatisierungen weiter Teile der Wirtschaft auch das Verständnis für den Wert des Gemeinwesens abhandengekommen. Prechts Erklärung ist nicht unumstritten. Klar scheint aber trotzdem, dass demokratische Staaten solidarische Bürger brauchen, damit sie funktionieren können.
Vielleicht hat die Pandemie doch noch ein Gutes: Sie zwingt uns, Begriffe wie Zusammenhalt und Gemeinwohl neu zu begründen. Und damit auch die Grenzen der
individuellen Freiheit, um die heute auf den Straßen so erbittert gestritten wird. Das Institut
für empirische Sozialforschung hat im September dieses Jahres untersucht, wie das Spannungsfeld zwischen Allgemeininteresse und individueller Freiheit wahrgenommen
wird. Fast jeder Zweite der eintausend Befragten gab an, dass es in Ordnung sei, die
Freiheitsrechte des Einzelnen zum Schutze der Gesundheit einzuschränken. Noch wichtiger als persönliche Freiheit war den Befragten der respektvolle Umgang miteinander. Der Befund sieht also gar nicht so schlecht aus.

„Je länger die Krise dauert, umso
schwächer wird der Zusammenhalt“,
sagt Konfliktforscherin Deitelhoff.
Aber der erste Eindruck ist trügerisch: Denn die Umfrage zeigt auch, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, nicht mehr selbst über ihr Leben bestimmen zu können: 17 Prozent der Befragten gaben an, keinen Einfluss darauf zu haben, was mit ihnen geschieht. Vor Corona waren das gerade einmal zehn Prozent gewesen.
Diese Zunahme könnte mit eine Erklärung dafür sein, dass die staatlich verordnete
Impfung bei einer Minderheit auf so großen Widerstand stößt. Wenn Arbeitsplätze
wackeln, soziale Kontakte per Verordnung eingeschränkt werden, dann steigt der
Eindruck, fremdbestimmt zu sein. Dass in so einem Kontext Verschwörungstheorien als willkommenes Erklärungsmuster dienen, ist nachvollziehbar. Die Verzweiflung mag auch erklären, warum die Stimmung auf den Demonstrationen aggressiver und bedrohlicher wird.
Die IFES-Studie belegt sehr eindrücklich, dass das Gewicht, das Bürger der Gemeinschaft
zumessen, mit deren finanzieller Situation zu tun hat. „Ob Menschen für eine gerechtere Gesellschaft oder für den Klimaschutz aktiv werden, hängt von Einkommen und Bildungsgrad ab“, sagt IFES-Geschäftsführerin Eva Zeglovits. Menschen mit höherer Bildung und Einkommen seien eher bereit, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, in einem Verein mitzuarbeiten oder Geld für einen guten Zweck zu spenden.
Felix Butzlaff, Politikwissenschafter an der Wirtschaftsuniversität Wien erklärt, dass sich auch politische Parteien immer schwerer täten, Allgemeinwohl zu definieren. „Parteien formulieren nicht mehr Erzählungen dessen, was sie als Allgemeinwohl anstreben“, schreibt Butzlaff in einem Gastkommentar in der Tageszeitung „Der Standard“. „Sie sondieren, was Bürger fordern. Die Definition des Allgemeinwohls hat sich individualisiert. Eine Diskussion darüber, ob Gemeinnutz nicht eben auch Verbote und Begrenzungen erfordert, wird dadurch enorm erschwert.“ Was fehle, seien von den Bürgern geteilte Legitimationsquellen, wie Christentum oder Sozialdemokratie. Dass Demokratie und Rechtsstaat für das Wohl
der Allgemeinheit sorgen können, werde von vielen heute nicht mehr als selbstverständlich
akzeptiert, wie die Demonstrationen gegen die „Corona-Diktatur“ zeigten.

„Am Ende bleiben derzeit das Individuum und die Nation als einzige Legitimationsquellen übrig“, schreibt Butzlaff. Er fordert eine Verständigung darüber, was Gemeinschaft und Demokratie für uns alle ausmacht. Politische Parteien sollten wieder zu Foren der Diskussion werden.
Und vielleicht wäre die Pandemie und ihre immensen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen Grund genug, wieder einmal darüber zu diskutieren, was den Menschen als „soziales und politischen Wesen“, wie ihn die Philosophie seit Aristoteles definiert, ausmacht. Denn Menschen brauchen, um leben zu können, Gemeinschaft und Zusammenhalt, auch dann, wenn es bedeuten kann, auf etwas verzichten zu müssen.
Fotocredit: Adobe Stock