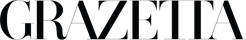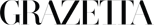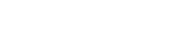Freundschaften sind ein wertvolles Gut. Sie bereichern unser Leben und unterstützen in schwierigen Lebenslagen. Das Magazin „Grazetta“ versucht im Gespräch mit Wissenschaftlern und Therapeuten, dem Geheimnis dieser einzigartigen Beziehung auf die Schliche zu kommen.
Für den griechischen Philosophen war die Sache ganz einfach: „Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern.“ Zeitgenössische Wissenschaftler tun sich mit einer Definition da schon deutlich schwerer. Nicht selten klingen die Versuche ein wenig umständlich: „Eine freiwillige Beziehung, die auf gegenseitiger Sympathie, Vertrauen und Unterstützung beruht, nicht aber auf Verwandtschaft oder einem sexuellen Verhältnis.“

Einfacher wird die Sache, wenn man versucht, die Bedingungen zu eruieren, die notwendig sind, damit zwischen zwei Menschen ein Band der Freundschaft entstehen kann. Die kanadische Soziologin Beverly Fehl von der Universität Winnipeg untersucht Freundschaften seit den 1990er Jahren. Sie hat vier Grundvoraussetzungen erhoben, die es braucht, damit Menschen zu Freunden werden können. Da ist zum einen einmal die räumliche Nähe: Zwei Arbeitskollegen, die sich ein Büro teilen, Studienkollegen, die gemeinsam für eine Prüfung lernen, zufällige Konstellationen wie diese können ausreichen, um Menschen einander näher zu bringen. Kontakthäufigkeit ist der zweite notwendige Faktor. Fehl nennt das den „Mere-Exposure-Effekt“. Oder weniger wissenschaftlich ausgedrückt: Damit Freundschaften entstehen können, braucht es Zeit. Aber nicht nur das: Beide Beteiligten brauchen auch so etwas wie soziale Kompetenz, also das Wissen, wie man dem anderen abhängig von der Situation begegnet. Als viertes Erfordernis macht Fehl die zwischenmenschliche Chemie fest. Die muss ganz einfach stimmen und die zwei Menschen müssen einander riechen können. Damit die Chemie stimmt, kann es helfen, dass die beiden ein paar Gemeinsamkeiten haben: Gleiche Interessen zum Beispiel oder eine vergleichbare soziale Herkunft.
Das bestätigt auch die Grazer Psychotherapeutin und Existenzanalytikerin Ursula Dobrowolski: „Ein gemeinsames Interesse steht oft am Anfang einer Freundschaft“, sagt sie. „Menschen begegnen einander in der Schule, im Job oder in einem Verein, da spielt oft der Zufall Regie.“

Neurowissenschaftlerin
Carmen Morawetz:
„Schon das Bild eines
Freundes hilft, die
eigenen Emotionen
zu regulieren.“
Damit aus einer zufälligen Nähe aber eine echte Begegnung werden kann, müssen die zwei Menschen aber auch etwas dafür tun. „In Beziehung stehen wir schnell einmal. Damit daraus eine Begegnung werden kann, muss man aktiv etwas dafür tun“, erklärt Dobrowolski. Interesse am anderen zeigen, ihn zu Gemeinsamkeit einladen oder ganz einfach miteinander Dinge tun. „Es braucht respektvolle Gegenseitigkeit, damit aus einer funktionalen Beziehung, wie der zwischen Arbeitskollegen, Freundschaft werden kann.“ Wie wichtig Freundschaften sind, hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie sehr eindrücklich vor Augen geführt. Alte Freunde nicht mehr besuchen zu können, nicht mit der besten Freundin ins Kino gehen zu können, was wir in unserem Leben bisher für selbstverständlich und alltäglich gehalten haben, war plötzlich nicht oder nur noch eingeschränkt möglich. Dabei betonen Soziologen einhellig, dass Freundschaften gerade heute wichtiger denn je sind: Familienstrukturen sind nicht mehr so stabil wie früher, Partner und Jobs wechseln öfter, nicht einmal die eigene Familie ist noch selbstverständlicher Garant für Geborgenheit. In einer alternden Gesellschaft werden Freundschaften noch wichtiger. Freunde springen ein, wenn Ehen auseinandergehen und Familien zerbrechen. Sie sind dann da, wenn man im Krankheitsfall praktische Unterstützung braucht.
Freunde machen stark, betonen viele Soziologen übereinstimmend.
Carmen Morawetz, Leiterin des Affective Neuro Lab an der Universität Innsbruck, wollte das genauer wissen. Die Professorin für affektive Neurowissenschaften am Institut für Psychologie hat mit Hilfe der Magnetresonanz untersucht, wie sich das Bild eines Freundes auf eine Person auswirkt, die mit einer negativen Situation konfrontiert wird. Als Gegenprobe hat sie dem Probanden Bilder fremder Personen gezeigt. „Das Ergebnis war eindeutig“, sagt Morawetz.
„Das Bild eines Freundes hat den Probanden geholfen, ihre Emotionen zu regulieren.“
In Zuge dieses Verhaltensexperiments hat sie 38 Personen getestet und bewiesen, dass allein das Bild eines Freundes helfen kann, mit belastenden Situationen besser umgehen zu können.
Freundschaften sind also gut für die seelische, aber auch für die körperliche Gesundheit. Sie fördern sogar die Lebenserwartung. Der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wenn man Freunde hat, braucht man keinen Psychotherapeuten.“ Ganz ernstgemeint wird er diese Behauptung wohl nicht haben. Außer Streit steht, dass Freundschaften Stabilität und Sicherheit geben. Ob es dabei zwischen Männer- und Frauenfreundschaften einen Unterschied gibt, ist Ansichtssache. Gemeinhin sagen Wissenschaftler, dass bei Frauen Mitgefühl, persönlicher Austausch und emotionale Unterstützung wichtig seien. Bei Männern ginge es eher um praktische Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten.

Existenzanalytikerin
Ursula Dobrowolski:
„In Beziehung stehen
wir schnell einmal.
Damit daraus eine
Begegnung werden
kann, muss man aktiv
etwas dafür tun.“
Die Existenzanalytikerin Ursula Dobrowolski ist skeptisch, wenn es um grobe geschlechtsspezifische Unterscheidungen geht: „Das Bindeglied zwischen Freunden ist der Dialog“, sagt sie. „Dialog bedeutet aber nicht nur Reden, er kann auch im Tun stattfinden.“ Es sei also nicht erheblich, was Menschen miteinander verbindet, sondern dass die beiden Gemeinsames, in welcher Form auch immer, erlebt haben. „Deshalb kann es auch gute Freundschaften zwischen einem Mann und einer Frau geben“, sagt sie. Es komme auch zwischen Männern und Frauen auf ein gemeinsames, für beide Beteiligten wichtiges Erlebnis an. Das könne Freundschaftsbeziehungen auch sehr robust machen. „Viele Menschen kennen das Gefühl: Man hat einen Freund viele Jahre lang nicht gesehen. Plötzlich steht man einander wieder gegenüber und beide haben das Gefühl, als wären sie nie getrennt gewesen“, sagt sie. In diesem Fall ist die verbindende Basis so stark, dass sie zeitliche und räumliche Trennungen überwinden kann.
Was aber passiert, wenn Freundschaften scheitern? Experten sprechen dann gerne von toxischen Freundschaften, also von Beziehungen, die einem der beiden Beteiligten mehr schaden als nützen. „Mit einem toxischen Freund hat man es dann zu tun, wenn er seinen Freund nur noch zum Ausweinen braucht und es nicht mehr um den anderen geht“, erklärt Dobrowolski. „Diese Menschen sind wie Vampire, die einem Energie und Kraft rauben.“
Nicht immer sei es einfach, diese Asymmetrie zu erkennen. Man fühle sich am Anfang ja oft geschmeichelt, wenn jemand einen um Mitgefühl bittet. Nur wenn das zum Dauerzustand werde und man das Gefühl bekomme, ausgenützt zu werden, müsse man reagieren. „Wenn es nur noch um das Abladen negativer Gefühle geht, dann hat man es mit emotionalem Missbrauch zu tun“, erklärt Ursula Dobrowolski.
Fotos: shutterstock, Universität Innsbruck, privat